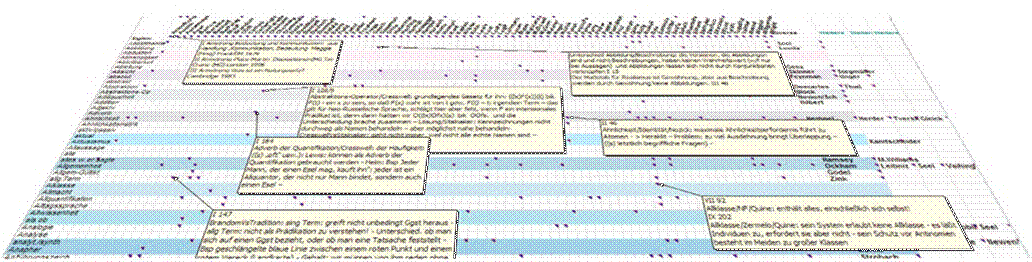Finden Sie Gegenargumente, in dem Sie NameVs…. oder….VsName eingeben.
Der gesuchte Begriff oder Autor findet sich in folgenden 2 Einträgen:
| Begriff/ Autor/Ismus |
Autor |
Eintrag |
Literatur |
|---|---|---|---|
| Extraversion | Ackerman | Corr I 168 Extraversion/Intelligenz/Ackerman: Die Assoziationen zwischen Extraversion und intellektuellen Fähigkeiten, und Bewusstsein und intellektuellen Fähigkeiten scheinen von vernachlässigbarer Größe zu sein. Kleine positive Korrelationen zwischen diesen Charakterzügen und Fähigkeiten werden ebenso häufig gefunden wie kleine negative Korrelationen. Es ist jedoch wichtig, ein zentrales Thema in Bezug auf diese beiden Charakterzüge im Auge zu behalten, das sich entweder von den intelligenzbezogenen Persönlichkeitskonstrukten oder sogar dem Neurotizismus unterscheidet. >Neurotizismus, >Charakterzüge, >Methode. Das heißt, was man für "normal" oder optimal hält, findet man nicht an einem Ende des Kontinuums der Charakterzüge, sondern irgendwo in der Nähe der Mitte. >Neurotizismus/Intelligenz/Ackerman. Theoretiker, die behauptet haben, dass Individuen, die weder zu viel noch zu wenig dieser Charakterzüge aufweisen, seien optimal angepasst (siehe z.B. Robinson 1989(1). Vgl.: Matthews 1985(2) hat jedoch für eine andere Sichtweise (Charakterzüge/MatthewsVsRobinson) angenommen, dass lineare Korrelationen keine geeigneten Maßnahmen sind, um das Verhältnis zwischen den Charakterzügen und den intellektuellen Fähigkeiten zu beurteilen. 1. Robinson, D. L. 1989. The neurophysiological bases of high IQ, International Journal of Neuroscience 46: 209–34 2. Matthews, G. 1985. The effects of extraversion and arousal on intelligence test performance, British Journal of Psychology 76: 479–93 Phillip L. Ackerman, “Personality and intelligence”, in: Corr, Ph. J. & Matthews, G. (eds.) 2009. The Cambridge Handbook of Personality Psychology. New York: Cambridge University Press |
Corr I Philip J. Corr Gerald Matthews The Cambridge Handbook of Personality Psychology New York 2009 Corr II Philip J. Corr (Ed.) Personality and Individual Differences - Revisiting the classical studies Singapore, Washington DC, Melbourne 2018 |
| Neurotizismus | Ackerman | Corr I 168 Neurotizismus/Intelligenz/Ackerman: Ein breiter Faktor des Neurotizismus (der in der Regel als breiter Angstfaktor, als Stressreaktion, als negativer Einfluss oder als negative Emotionalität angesehen wird) zeigt konsistente negative Korrelationen mit einer Reihe von allgemeinen und spezifischen intellektuellen Fähigkeiten (z.B. in der Größenordnung von r = -.15 mit allgemeiner Intelligenz). Die Korrelationen zwischen den Merkmalen des Neurotizismus und den mathematischen Fähigkeiten sind in der Regel größer als die Korrelationen zwischen Neurotizismus und verbalen Fähigkeiten, obwohl die Unterschiede nicht groß sind. >Charakterzüge, >Stress, >Intelligenz. Theoretiker, die behauptet haben, dass Individuen, die weder zu viel noch zu wenig dieser Charakterzüge nachweisen, seien optimal angepasst (siehe z.B. Robinson 1989(1). Vgl.: Matthews 1985(2) hat jedoch für eine andere Sichtweise (Charakterzüge/MatthewsVsRobinson) angenommen, dass lineare Korrelationen keine geeigneten Maßnahmen sind, um das Verhältnis zwischen den Charakterzügen und den intellektuellen Fähigkeiten zu beurteilen. >Fähigkeiten, >Leistungsfähigkeit. 1. Robinson, D. L. 1989. The neurophysiological bases of high IQ, International Journal of Neuroscience 46: 209–34 2. Matthews, G. 1985. The effects of extraversion and arousal on intelligence test performance, British Journal of Psychology 76: 479–93 Phillip L. Ackerman, “Personality and intelligence”, in: Corr, Ph. J. & Matthews, G. (eds.) 2009. The Cambridge Handbook of Personality Psychology. New York: Cambridge University Press |
Corr I Philip J. Corr Gerald Matthews The Cambridge Handbook of Personality Psychology New York 2009 Corr II Philip J. Corr (Ed.) Personality and Individual Differences - Revisiting the classical studies Singapore, Washington DC, Melbourne 2018 |