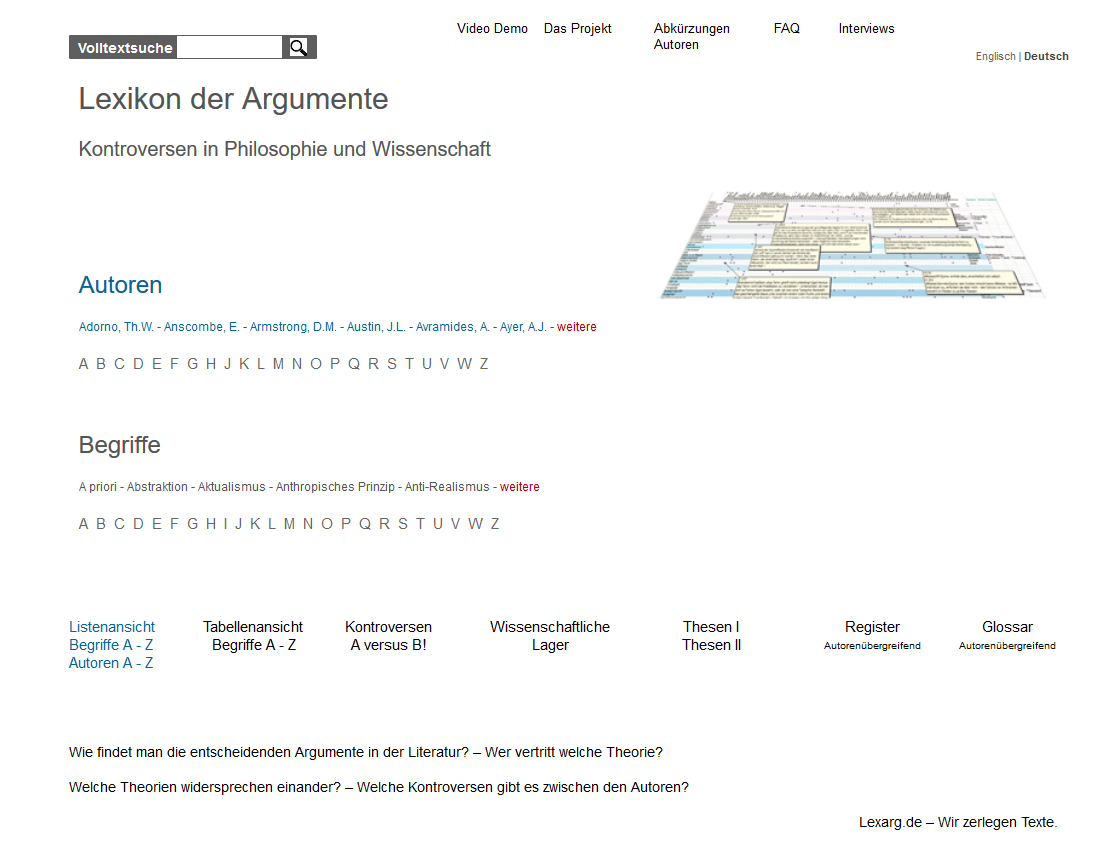Wirtschaft Lexikon der ArgumenteHome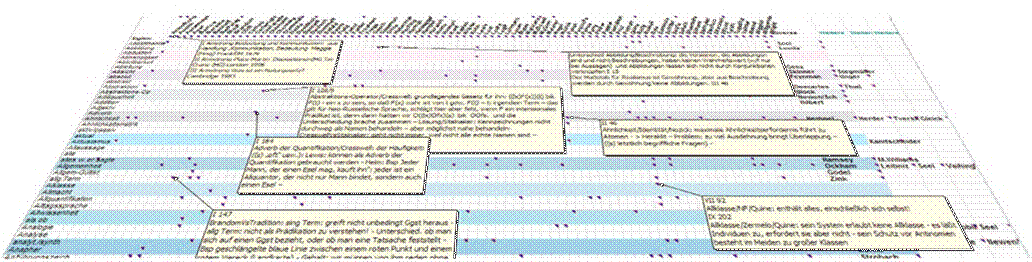
| |||
|
| |||
| Rechte: Rechte in einer Gesellschaft sind die grundlegenden Freiheiten und Ansprüche, die jedem Menschen zustehen, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Sprache, Religion oder einem anderen Status. Sie sind eine wesentliche Voraussetzung für die Menschenwürde und ermöglichen es den Menschen, frei zu leben und an der Gesellschaft teilzuhaben. Siehe auch Menschenrechte, Grundrechte, Gesellschaft, Justiz, Rechtsprechung, Gesetz, Gesetze, Gerechtigkeit, Partizipation._____________Anmerkung: Die obigen Begriffscharakterisierungen verstehen sich weder als Definitionen noch als erschöpfende Problemdarstellungen. Sie sollen lediglich den Zugang zu den unten angefügten Quellen erleichtern. - Lexikon der Argumente. | |||
| Autor | Begriff | Zusammenfassung/Zitate | Quellen |
|---|---|---|---|
|
Ronald Dworkin über Rechte – Lexikon der Argumente
Brocker I 597 Rechte/Dworkin: These: Die Rechte sind nicht etwas Fertiges, das von uns entdeckt würde. Vielmehr gewinnen wir sie auf dem Wege einer argumentativen Vermittlung und Verknüpfung möglichst vieler unserer zentralen Überzeugungen. Dies nennt Dworkin „konstruktive Interpretation“ (1). Interpretation/Dworkin: handelt aber nicht von moralischen Rechten; diese bilden einen Hintergrund, auf dem Gerichte über die Existenz konkreter institutioneller Rechte zu befinden haben. Juristische Rechte/Dworkin: sind Geschöpfe sowohl der Geschichte als auch der Moral. (2) StavropoulosVsDworkin: damit entsteht der Eindruck einer hybriden ((s) zweigeteilten) Theorie, in der die Prinzipien für den moralischen, der Positivismus für den historischen Teil zuständig sei. (3) Problem: die beiden Enden der Rechtsbegründung wären dann unverbunden. DworkinVsVs: es geht um eine rationale Rekonstruktion des Rechts als Ganzem. (Dworkin 1986) (1). Brocker I 601 Rechte/Individuen/Dworkin: Rechte schützen immer das Individuum mit Bezug auf grundlegende und zentrale Interessen. Dworkin will nicht sagen, dass alle Rechte absolut gelten wie wohl das Folterverbot. Der grundlegende Punkt ist wiederum ein logischer: Rechte spielen nur dann eine eigene normative Rolle, wenn sie kollektive Ziele in Konfliktfällen ausstechen. Andernfalls könnte man sich für jede beliebige Rechtfertigung auch direkt auf die Zielsetzung beziehen (4). Ebenso wären Rechte gegenstandslos, wenn sie Individuen nie zu einem Gesetzesbruch berechtigten. Auch formal korrekt erzeugte, Brocker I 602 ja sogar höchstrichterlich bestätigte Rechtsnormen könnten gleichwohl Unrecht sein, weil sie individuelle Rechte verletzen. >Ziviler Ungehorsam, >Bürgerrechte/Dworkin. Das aber heißt, dass sich Bürgerrechtler für einen Gesetzesbruch nicht unbedingt auf Gewissensgründe berufen müssen. Sie können argumentieren, dass die Regelungen, gegen die sie verstoßen, tatsächlich illegal seien, weil sie existierende Rechte verletzten (5). 1. Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, Mass./London 1986. 2. Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass. 1977 (erw. Ausgabe 1978). Dt.: Ronald Dworkin, Bürgerrechte ernstgenommen, Frankfurt/M. 1990, S. 153 3. Stavropoulos, Nicos, »Legal Interpretivism«, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014, 〈https://plato.stanford.edu/entries/law-interpretivist/〉, letzter Zugriff 16. 02. 2017. 4. Dworkin 1990, S. 161f. 5. Ebenda S. 349-352. Bernd Ladwig, „Ronald Dworkin, Bürgerrechte ernstgenommen“ in: Manfred Brocker (Hg.) Geschichte des politischen Denkens. Das 20. Jahrhundert. Frankfurt/M. 2018_____________ Zeichenerklärung: Römische Ziffern geben die Quelle an, arabische Ziffern die Seitenzahl. Die entsprechenden Titel sind rechts unter Metadaten angegeben. ((s)…): Kommentar des Einsenders. Übersetzungen: Lexikon der ArgumenteDer Hinweis [Begriff/Autor], [Autor1]Vs[Autor2] bzw. [Autor]Vs[Begriff] bzw. "Problem:"/"Lösung", "alt:"/"neu:" und "These:" ist eine Hinzufügung des Lexikons der Argumente. |
Dworkin I Ronald Dworkin Taking Rights Seriously Cambridge, MA 1978 Brocker I Manfred Brocker Geschichte des politischen Denkens. Das 20. Jahrhundert Frankfurt/M. 2018 |
||